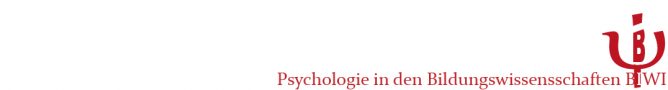Im Folgenden können Sie sich über unsere vergangene und abgeschlossene Forschungsprojekte informieren.
Diese sind sowohl von aktuellen, als auch ehemaligen Mitarbeitenden aufgelistet. Die jeweiligen Kontakte finden Sie entsprechend den Forschungsprojekten anschließend.
Das Projekt hat zum Ziel, Gelingensbedingungen und Auswirkungen von Mentoring-Unterstützung für angehende Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst zu erforschen. Die Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Lehramtsanwärterinnen und -anwärter sind dabei genauso von Interesse wie ihre Selbstwirksamkeit, ihre subjektiven Kompetenz-Einschätzungen und professionellen Überzeugungen. Die Ableitung praktischer Implikationen für die Gestaltung von Mentor-Mentee-Beziehungen in der Lehramtsausbildung ist dabei von besonderer Bedeutung.
Die Datengrundlage für aktuelle Untersuchungen bilden Selbstberichte angehender Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, die im Rahmen des Projekts „Evaluation der Lehrkräfteausbildung unter besonderer Berücksichtigung des Vorbereitungsdienstes in Rheinland-Pfalz: Phasenübergreifende Kompetenzentwicklung“ unter Leitung von Frau Prof. Margarete Imhof erhoben wurden.
Veröffentlichungen aus dem Projekt:
Burger, J., Bellhäuser, H., & Imhof, M. (2021). Mentoring styles and novice teachers’ well-being: The role of basic need satisfaction. Teaching and Teacher Education, 103, 103345. https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103345
Projektverantwortlicher:
Dr. Dipl.-Psych. Julian Burger
Die professionelle Entwicklung von Lehrerinnen und Lehrern vollzieht sich auch in Rheinland-Pfalz in mehreren Phasen: Dem Studium in lehramtsbezogenen Studiengängen (1. Phase) folgt der Vorbereitungsdienst (2. Phase), der zur dritten Phase, der Fort- und Weiterbildung inklusive des Berufseinstieges hinführt. Für die Ausgestaltung des Studiums sind die Universitäten zuständig, während für den Vorbereitungsdienst die Studienseminare verantwortlich sind. Die zwei ersten Phasen der Lehramtsausbildung sind in Rheinland-Pfalz dadurch verzahnt, dass die angehenden Lehrkräfte Schulpraktika während des Studiums durchlaufen, die in der Verantwortlichkeit der Studienseminare liegen. Ein Gesamtbild über die professionelle Entwicklung in dieser gestuften und von mehreren Institutionen geleisteten Ausbildung fehlt weitgehend. Mit diesem Forschungsprojekt unternehmen wir einen ersten Schritt, um relevante Faktoren und Entwicklungslinien in der ersten und zweiten Phase der Lehrkräftebildung zu erfassen.
Prof. Dr. Margarete Imhof
Mitantragsteller/innen:
Prof. Dr. Daniel Dreesmann,
Prof. Dr. Oliver Meyer,
Prof. Dr. Sylvia Thiele
Projektverantwortliche:
Dr. Bozana Meinhardt-Injac
Annette Otto, Ph.D.
Dr. Eszter Monigl, Die Auswirkung emotionaler Fertigkeiten ist bei Kindern und Jugendlichen vielschichtig. Forschungsergebnisse belegen, dass das Vorhandensein einer altersentsprechenden Emotionalen Kompetenz sowohl für die psychosoziale Entwicklung als auch für die kognitiven Leistungen von großer Bedeutung ist. Zielsetzung des Projekts ist die Operationalisierung von emotionalen Fähigkeiten für ein quantitatives Fragebogenverfahren, das auch als Gruppentest einsetzbar ist. Für diesen Zweck wurde emotionale Kompetenz unter Berücksichtigung von Forschungsergebnissen als ein Konstrukt von drei Fertigkeitsbereichen definiert: Umgang mit eigenen Emotionen, Umgang mit Emotionen anderer und Emotionswissen. Theoriegeleitet wurde eine mehrdimensionale Testbatterie zur Erfassung emotionaler Kompetenz mit subjektiven und objektiven Subskalen für Kinder und Jugendliche (EKO-KJ, ab 10 Jahren) entwickelt. Die Evaluation erfolgte mit Schülerinnen und Schülern aus allen Regelschulformen (N = 817, Alter M = 13.78, SD = 2.22). Die Reliabilitätsmaße der Subskalen sind zufriedenstellend bis sehr gut zu bewerten. Derzeit werden die Validitätsmaße ermittelt und das Testmanual zur Veröffentlichung vorbereitet. Projektmitarbeitende: Das Präventionsprogramm Ich und Du und Wir (IDW) wird mit Unterstützung der LBS und den Sparkassen in Rheinland-Pfalz an Grundschulen eingesetzt, um die soziale Kompetenz der Schülerinnen und Schüler zu fördern. Ziele des Trainings sind die verbesserte Selbstwahrnehmung, differenziertere Wahrnehmung von Gefühlen und Befindlichkeiten des anderen und Entwicklung von kooperativen und integrativen Fähigkeiten in der Klasse. Das Programm wurde seit Februar 2008 durch eine Datenerhebung mit dem Ziel einer Evaluation begleitet. Um die Programmevaluation zu vertiefen, aus der sich auch Schlussfolgerungen für die zukünftige Arbeit des Programms begründet ableiten lassen, sind weitere Evaluationsschritte erforderlich. Bei der Betrachtung der bisher geleisteten Arbeit und der Ergebnisse der Evaluation wurde deutlich, dass für die weitere Entwicklung der Arbeit mit IDW die Bedingungen, unter denen das Programm vor Ort jeweils implementiert worden ist, näher zu analysieren sind. Das betrifft die Entscheidungen für das Programm ebenso wie das Training und die Begleitung der Lehrer und Lehrerinnen, Umfang, Intensität und Dauer der Umsetzung und den Fortbildungsbedarf der beteiligten Personen. Aufgrund der Heterogenität der Vorgehensweisen über die verschiedenen Schulen hinweg, ist noch nicht ausreichend klar, aufgrund welcher Maßnahmen positive Effekte des Programms bei Schülerinnen und Schülern, bei Lehrerinnen und Lehrern, aber auch in der Beziehung zwischen diesen Gruppen, zu erwarten sind. Es ist geplant, die relevante Personengruppen zu befragen: Schüler und Schülerinnen unter-schiedlicher Jahrgangsstufen mit und ohne IDW-Erfahrung, Lehrer und Lehrerinnen an den Schulen, Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen, die IDW durchgeführt haben bzw. Kontakt hatten mit Klassen, die mit IDW gearbeitet haben, Personen in der Schulleitung und Schulaufsicht, die involvierten Schulpsychologen und ggf. auch Elternvertreter. In Bezug auf die organisatorischen Rahmenbedingungen ist der Kontext zu untersuchen, in dem IDW eingeführt wurde (z.B. welche anderen Programme laufen sonst noch, welchen Freiraum schafft die Schule für IDW) und in welchem Umfang IDW an einer Schule implementiert wurde. An kritischen Ereignissen soll dokumentiert werden, in welcher Relation IDW zur Einführung der neuen Grundschulordnung steht, welche Rolle die Pädagogische Konferenz, Zeitpunkt und Form des Studientages, Schulleiterwechsel und andere Faktoren des Schulalltags spielen. Projektleitung: Projektmitarbeitende: Christine Eckert, Mit dem zunehmenden Einsatz interaktiver Medien wie Smartboards oder Tablet- Computer im Schulunterricht und in der Hochschullehre ist unter anderem die Hoffnung verbunden, dass sich damit die Lernmotivation und die Lernleistungen verbessern lassen. Trotz dieser hohen Erwartungen fehlt es aber sowohl an einem theoretischen Rahmen, vor dessen Hintergrund die Anforderungen, die das Lernen mit interaktiven Medien an die Lernenden stellt, analysiert werden können als auch an fundierten experimentellen und kognitionspsychologisch ausgerichteten Studien, die sich mit den Auswirkungen des Lernens mit interaktiven Medien auf das Arbeitsgedächtnis der Lernenden befassen. In dem Forschungsprojekt soll deshalb untersucht werden (1) inwieweit interaktiv und multimedial/multimodal gestaltete Lernumgebungen die Arbeitsgedächtniskapazität beanspruchen und ob sich aus dieser Beanspruchung, je nach individueller Ausprägung der Kapazität, differentielle Effekte im Hinblick auf die Lernleistung ergeben, (2) ob die Belastungen, die sich aus der Interaktivität und multiplen Repräsentationsformaten ergeben, kumulativ wirken, (3) ob die Anforderungen an die Arbeitsgedächtniskapazität, die das Lernen mit interaktiv und multimedial/multimodal gestalteten Lernumgebungen mit sich bringt, durch metakognitive Hilfen besser bewältigt werden können und ob die Effektivität dieser Hilfen durch interindividuelle Differenzen in der Arbeitsgedächtniskapazität moderiert wird. Auf der Basis der Ergebnisse dieser Studien sollten sich Empfehlungen für die Gestaltung und den Einsatz von interaktiven, multimedialen/multimodalen Lernumgebungen ableiten lassen. Zur finanziellen Unterstützung des Projektes wurden Sach- und Personalmittel bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) beantragt. Projektleitung: Projektverantwortliche: Die Evaluation des Trainings erfolgte im Rahmen einer quasiexperimentellen Untersuchung, im Kontrollgruppendesign an vier Hauptschulen und vier Realschulen in Baden-Württemberg und Bayern mit insgesamt 491 Schülern (Treatment N = 357, Alter M = 14.07, SD = 0.82). Die qualitative Analyse der schriftlichen Rückmeldungen bestätigen, dass das Training in der Schule ohne besondere Aufwendungen durchführbar ist und von den Jugendlichen insgesamt positiv aufgenommen wurde. Die Auswertung der quantitativen mit standardisierten Testverfahren im Bereich Selbstwert, Berufswahl, Selbstdarstellung, Handlungsorientierung, Selbstwirksamkeit und Motivation erhobenen Daten werden zur Publikation vorbereitet. Projektverantwortliche: Gefördert durch: Projektverantwortliche: Projektverantwortliche: Der Fokus der bisherigen Stereotype Threat-Forschung liegt v.a. auf Mädchen/Frauen und Mathematik. Dieses Projekt stellt dahingehend eine Erweiterung dar, dass die Leseleistungen von Jungen in einer negativ stereotypisierten Situation untersucht werden. Ferner ist von Interesse, welche Variablen wichtige Mediatoren (affektiv, kognitiv, motivational) und Moderatoren (domain und gender identification) darstellen. In einer ersten Studie mit Schülern achter Klassen (Gymnasium; N = 196) zeigte sich, dass Jungen in der Threat-Bedingung signifikant bessere Leseleistungen erzielten als Jungen in der Non-Threat-Bedingung. Eine erste Vermutung legt nahe, dass sich Jungen in der Threat-Bedingung stärker herausgefordert fühlten, aktiv gegen das negative Stereotyp anzukämpfen, und aus diesem Grunde bessere Leistungen erzielten. Eine Folgestudie mit 547 Schülern (Gymnasium, Realschule Plus) scheint dieses Ergebnis zu bestätigen, wird aber gegenwärtig noch ausgewertet. Basierend auf diesen ersten Ergebnissen scheinen Jungen und Mädchen unterschiedlich auf Bedrohungssituationen und damit auf „ihr” Stereotyp zu reagieren. Weitere Auswertungen folgen. Projektverantwortliche: Projektverantwortliche:
Dipl.-Psych., Dipl.-Soz.-Päd. Dagmar Treutner
Dr. Simone Ohlemann,
Dr. Eszter Monigl
Prof. Dr. Michael Behr (Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd)
Prof. Dr. Margarete Imhof
Myriam Schlag
Im Zeitraum Oktober 2013 bis September 2014 durch das Zentrum für Bildungs- und Hochschulforschung (ZBH) gefördert.
Dr. Christiane Baadte,
Prof. Dr. Margarete Imhof
Dr. Eszter Monigl
Prof. Dr. Michael Behr (Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd)
Prof. Dr. Michael Behr (Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd, Projektleitung)
Dr. Eszter Monigl
Robert Bosch Stiftung
Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd
Dr. Tatjana Hilbert
Dr. Sabine Fabriz
Dr. Eszter Monigl
Dipl.-Psych. Christine Eckert
Tatjana Spaeth-Hilbert